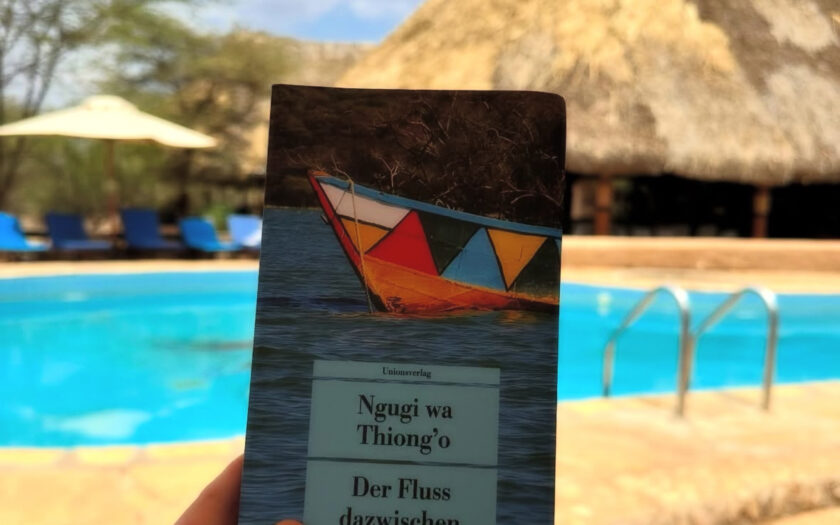Der Fluss dazwischen hat mich sofort in seinen Bann gezogen – nicht mit Action oder großen Wendungen, sondern mit einer stillen, eindringlichen Kraft. Ngugi wa Thiong’o erzählt hier von zwei Dörfern in Kenia, die durch einen Fluss getrennt sind, aber vor allem durch etwas viel Tieferes: die Kollision von Tradition und Kolonialismus, von christlicher Mission und indigenen Glaubenswelten, von Zugehörigkeit und Selbstverlust.
Im Mittelpunkt steht Waiyaki, der Sohn eines angesehenen Ältesten. In ihm bündeln sich all die Spannungen der Zeit: Er wird auf einer Missionsschule ausgebildet, gleichzeitig trägt er die Erwartungen seines Volkes, seine Kultur zu bewahren. Er soll Brücke und Zukunft sein, Heiler der Spaltung – und scheitert genau daran, weil die Welt um ihn herum längst zu zerrissen ist.
Das Beeindruckende an diesem Roman ist seine Klarheit. Ngũgĩ schreibt schlicht, aber kraftvoll, und schafft damit Bilder, die lange nachhallen: Rituale am Fluss, heimliche Treffen in der Dämmerung, scharfe Debatten über Glauben und Identität, die explodierende Wut derjenigen, denen der Boden unter den Füßen gezogen wird. Die Missionare bringen Bildung – ja. Aber sie bringen auch Zweifel. Spaltung. Und einen moralischen Imperialismus, der alles überrollt.
Waiyakis Liebe zu Nyambura, der Tochter eines streng christlichen Konvertiten, gibt dem Roman eine bittersüße Note. Zwei junge Menschen, die eigentlich nur leben und lieben wollen – und doch zwischen unvereinbaren Welten stehen. Ihre Beziehung ist leise und zart, aber sie trägt das Gewicht ganzer Kulturen.
Am stärksten fand ich, wie Der Fluss dazwischen die Idee des „Dazwischen-Seins“ einfängt. Nichts ist eindeutig. Niemand ist vollkommen gut oder böse. Und der große Konflikt ist weniger äußerlich als innerlich: Wie bleibt man sich treu, wenn die eigene Welt ins Wanken gerät?
Der Roman ist kurz, aber er trägt so viel in sich: Kolonialgeschichte, Religionskritik, Identitätsfragen, Liebe, Verlust. Und vor allem diese ungeheure Traurigkeit darüber, wie ein Land, eine Kultur, ein Volk in Stücke gerissen werden – nicht durch einen einzigen Schlag, sondern durch viele kleine Risse.